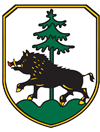Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
herzlich willkommen beim Solarpotenzialkataster des Landkreises Ebersberg!
Mit diesem Online-Tool bekommen Sie für Ihr Gebäude eine genaue Analyse darüber, ob und wie Ihr Dach für die Nutzung von Sonnenenergie geeignet ist – und das vollkommen kostenlos. Zusätzlich erhalten Sie Tipps zur Planung und zum Bau einer eigenen Solaranlage sowie wertvolle Links auf weiterführende Seiten.
Bitte beachten Sie, dass die Analyseergebnisse des Solarpotenzialkatasters auf einem automatisierten Verfahren basieren (die Datenbasis bilden Laserscandaten aus den Jahren 2020 bis 2022). Die Ergebnisse dienen Ihrer ersten Information, ersetzen aber nicht eine qualifizierte Fachberatung und erfolgen ohne Gewähr.
Das Team der Energieagentur Ebersberg-München gGmbH unterstützt Sie gerne bei Fragen zum Solarpotenzialkataster und zu Ihrer persönlichen Solaranlage. Beachten Sie dazu bitte die Informationen zum Beratungsangebot auf der Website: www.energieagentur-ebe-m.de
Die Umsetzung des Solarpotenzialkatasters für den Landkreis Ebersberg ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität und wurde mit Begleitung des Klimaschutzmanagements des Landkreises Ebersberg ermöglicht. Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden können durch diese Initiative zu einer nachhaltigen Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien in der Region beitragen.
Wir laden Sie ein, sich auf diesen Seiten zu informieren und Anregungen für Ihre eigene Solaranlage zu sammeln!
Ihr Klimaschutzmanagement des Landkreises Ebersberg
und die Energieagentur Ebersberg-München gGmbH
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Energieagentur Ebersberg-München gGmbH
Telefon: 08092 33 090-30
E-Mail: info@ea-ebe-m.de
www.energieagentur-ebe-m.de